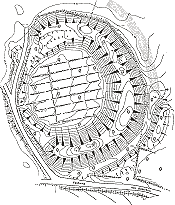Ringwallanlage „Heidenwall“**
bei Delthun, Gemeinde Ganderkesee
Erlebnisroutenstation Nr. 21

Parkmöglichkeit: am Straßenrand (ca. 500 m)

Öffentl. Verkehrsmittel: Nordwestbahn Bremen – Osnabrück, Bhf. Ganderkesee (ca. 3,5 km)

Rollstuhleignung: sehr bedingt (unebenes Gelände, „Heidenwall“ nicht befahrbar)

Gastronomie: mehrere gastronomische Betriebe in Ganderkesee (ca. 3,5 km)
Eindeutig ist der so genannte, 4 m hohe „Heidenwall“ zu den beeindruckendsten Wallanlagen der Region zu zählen. Einen kurzen Abstecher dorthin sollten Sie keinesfalls versäumen.

"Heidenwall" bei Delthun, Blick von Nordwesten

Blick von Südosten
Anfahrt:
Radfahrer und Radfahrerinnen: Der „Heidenwall“ ist in die Route 1 der archäologischen Erlebnisrouten „Faszination Archäologie“ eingebunden. Unsere als pdf-Dokumente erhältlichen ausführlichen Routenbeschreibungen führen Sie unmittelbar zur Ringwallanlage.
Sollten Sie mit dem PKW anreisen, fahren Sie bitte die K 232 von Ganderkesee
nach Bergedorf. Am Wohnplatz Delthun biegen Sie an der Kreuzung links ab (Straße
"Am Heidenwall"), den nächsten Feldweg befahren Sie bitte schräg rechts bis zum
Waldstück der Wallanlage (ca. 500 m).
Burggeschichte(n): Eine Burg heidnischer Herkunft?
Der „Heidenwall“ bei Delthun gehört zu dem in Nordwestdeutschland verbreiteten Typus ovaler Ringwallanlagen, die man auch als „Wallburgen“ bezeichnet (s. auch Arkeburg (23)). Vom 9. Jahrhundert bis ins hohe Mittelalter entstanden sie zum Schutze vor ungebetenen fremden Eindringlingen oder auch als Stützpunkte bei kriegerischen Auseinandersetzungen untereinander. Der „Heidenwall“ bei Delthun ist nicht der einzige Vertreter seines Namens. „Heidenwälle“ und sogar „Heidenmauern“ durchziehen das gesamte Land. Ihr Name fußt auf der inzwischen vielerorts widerlegten Vermutung, sie seien zu vorchristlicher Zeit errichtet worden.
Speziell der „Heidenwall“ bei Delthun wurde vermutlich im 9. oder 10. Jahrhundert errichtet. Ob die beachtliche, 4 m hohe Umwallung als Holz-Erde-Konstruktion oder aber als zweischalige Plaggenmauer mit Erdkern ausgeführt wurde, ist bislang unbekannt. Die Maße des gestreckten ovalförmigen, Nordwest-Südost orientierten Grundrisses belaufen sich auf 82,5 x 66 m. Der Wall wird im Nordosten sowie im Osten von einem lediglich 1 m tiefen, aber immerhin 6 m breiten Graben umfasst. An diesen schließt sich ein weiterer Wall – der Außenwall – mit einer Höhe von 1 m und einer Breite von 5 m an. Hier stieß man in jüngerer Vergangenheit auf einen bronzenen Halsring. Als so genannter „Hortfund“, d.h. als mutmaßliche Opfergabe, war er schon in der jüngeren Bronzezeit im Erdreich vergraben worden.
Heidenwall bei Delthun,
Neuvermessung durch die Fachhochschule Oldenburg
(H.-M. Hartmann). Archäologische Bearbeitung: Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege (J. Greiner, H.-W. Heine).
Aus: Archäologische Denkmäler zwischen Weser und Ems. 2000
Der ursprüngliche Eingang des „Heidenwalls“ wird im nordwestlichen Bereich vermutet. Möglicherweise schloss der Wall entstehungszeitlich unmittelbar an eine Siedlungskammer an und war im Besitz einer frühen adligen Grundherrschaft. Andere Theorien hingegen besagen, die Anlage habe vorrangig der Wegekontrolle gedient.

Besuchen Sie auch folgende archäologische Sehenswürdigkeiten in der Nähe:
Hügelgrab am Flugplatz Ganderkesee (ca. 3 km)
Großsteingräber bei Steinkimmen(ca. 4,5 km)
Großsteingrab bei Stenum(ca. 10 km)